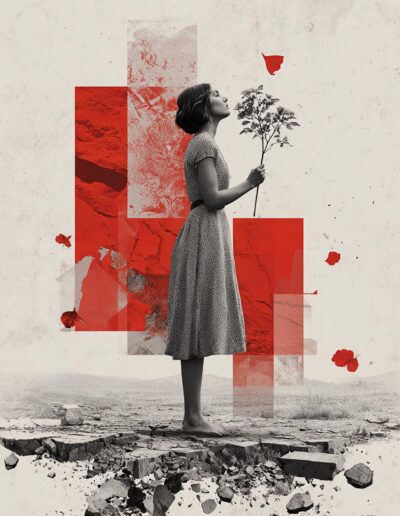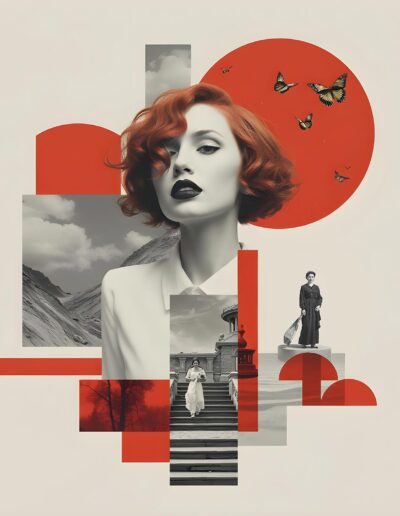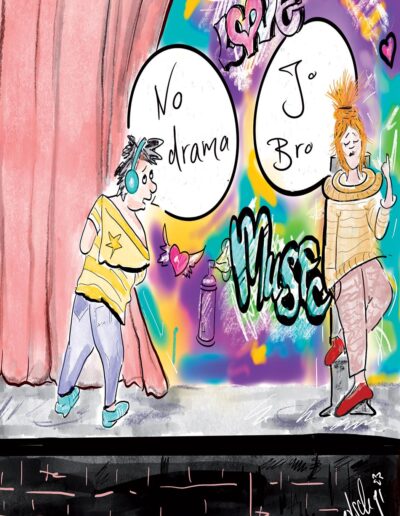Der Begriff „Meritokratie“ ist in letzter Zeit populär geworden und wird von gewissen Kreisen als Gegenteil von Diversity-, Equity- und Inclusion-Initiativen positioniert. Wir fragen die Autorinnen des „Gender Intelligence Report“, Dr. Ines Hartmann und Alkistis Petropaki, was eine echte Meritokratie ausmacht und wie wir diese erreichen.

Alkistis Petropaki ist seit 2015 General Manager von Advance. Sie war über 20 Jahre in internationalen Führungspositionen tätig, darunter für L’Oréal, Nestlé oder Lindt & Sprüngli. Sie hält einen MBA der ESCP-EAP und hat einen Master in Germanistik und Psychologie.
Dr. Ines Hartmann leitet gemeinsam mit Prof. Dr. Gudrun Sander das Kompetenzzentrum für Diversity & Inclusion der Universität St.Gallen. Sie ist mitverantwortlich für das HSG Diversity Benchmarking und leitet unternehmensspezifische Projekte zu inklusiver Führung und Diversity & Inclusion.

Ladies Drive: Ines, Alkistis, eine grundlegende Frage: Was bedeutet Meritokratie? Und ist sie tatsächlich inkompatibel mit Diversität, Chancengleichheit und Inklusion?
Alkistis: Genau dieses Missverständnis müssen wir aufklären und greifen das Thema deshalb in der neuen Ausgabe des „Gender Intelligence Report“ auf. Kurz gefasst verspricht Meritokratie, dass die am besten geeigneten Personen befördert oder in Führungspositionen eingestellt werden beziehungsweise jene, die es basierend auf ihren Leistungen, Qualifikationen und ihrem Potenzial verdienen. „Merit“ bedeutet ja nichts anderes als „Verdienst“.
Damit dieses schöne Ideal Wirklichkeit wird, müssen alle Talente – beispielsweise unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft – eine echte Chance haben, diese Verdienste zu erreichen. Und genau das ist das Ziel von Diversity-, Equity- und Inclusion-Initiativen: echte Chancengleichheit, Transparenz und Fairness zu schaffen. Es ging nie darum, den bisherigen Führungskräften Privilegien wegzunehmen und sie hin zu Frauen und Minderheiten zu verschieben. Das ist eine ideologisch geprägte Auslegung jener, die sich die alte Ordnung zurückwünschen.
Ines: Der entscheidende Punkt ist, dass „Meriten“ weder objektiv noch universelle Standards sind. Sie sind gesellschaftlich konstruiert und damit von kulturellen Normen geprägt. Das trifft ganz besonders auf den Faktor „Potenzial“ zu. Es ist gut belegt, dass Männern unbewusst mehr Führungspotenzial zugeschrieben wird als Frauen. Hier wird die Verbindung zu Diversity, Equity und Inclusion absolut vital.
Alkistis: Tatsächlich gibt es keine echte Meritokratie ohne Inklusion. Sie sind nicht nur kompatibel – sie bedingen einander und sind ein eigentliches Traumpaar. Wenn wir ein wirklich meritokratisches System wollen, brauchen wir die Werkzeuge und Praktiken, die DE&I bietet, um Vorurteile zu eliminieren und Transparenz und Chancengleichheit zu schaffen.
Findet ihr, dass wir heute in der Geschäftswelt in einem meritokratischen System operieren?
Ines: Jein. Wir operieren in einer „biased“ Meritokratie, die noch sehr viele blinde Flecken und strukturelle Hürden beinhaltet. Klare Belege dafür sehen wir zum Beispiel bei den Beförderungen. Hier gibt es immer noch erhebliche Unterschiede bei den Aufstiegsraten der verschiedenen demografischen Gruppen oder beispielsweise auch, wenn Personen nicht 100 Prozent arbeiten. Übrigens ist auch der unerklärbare Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern ein klares Zeichen dafür, dass wir noch nicht wirklich meritokratisch sind.
Alkistis: Bei Einstellungen wissen wir, dass identische Lebensläufe mit unterschiedlichen Namen verschiedene Rücklaufquoten erhalten. Das sind keine leistungs- oder qualifikationsbasierten Entscheidungen – sie werden von unbewussten Vorurteilen und systemischen Barrieren beeinflusst. Und diese verhindern, dass wirklich immer die besten Talente erkannt und gefördert werden können.
Was braucht’s, damit wir echte Meritokratie, dieses Ideal der Businesswelt, erreichen?
Ines: Erstens ist Transparenz nicht verhandelbar. Jede und jeder muss wissen, was in ihrer oder seiner Organisation notwendig ist, um als Talent anerkannt zu werden oder eine Führungsposition zu erreichen. Wenn dies bekannt ist, können Kandidat:innen auch viel objektiver miteinander verglichen werden.
Alkistis: Zweitens müssen wir strukturelle und wahrnehmungsbezogene Barrieren eliminieren. Hier stehen inklusive Führungspraktiken im Zentrum. Es reicht nicht zu denken: „Bei uns gibt es keine Vorurteile“ – wir brauchen systematische Ansätze, um sie zu identifizieren und zu beseitigen.
Ines: Und schliesslich müssen wir erkennen, dass Zugehörigkeit kein „Nice-to-have“ ist – es ist ein Geschäftsimperativ. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, dass sie gehört und für ihre Beiträge wertgeschätzt werden, entfalten sie ihr volles Potenzial, bringen ihre beste Leistung und sind gegenüber ihren Arbeitgebenden loyal.

Der neue „Gender Intelligence Report“ erscheint am 18. September 2025 und widmet sich dem Thema „Meritokratie“.
Premiere des „Gender Intelligence Report“: Livestream am 18. September von 16:00 bis 18:00 Uhr (auf Englisch).